Welche Art von Evidenz hilft Lehrkräften, ihren Unterricht zu verbessern?
Prof. Dr. Alexander Renkl von der Universität Freiburg erläutert in diesem Meinungsbeitrag, warum Lehrkräfte vermehrt mit Theorien arbeiten sollten.
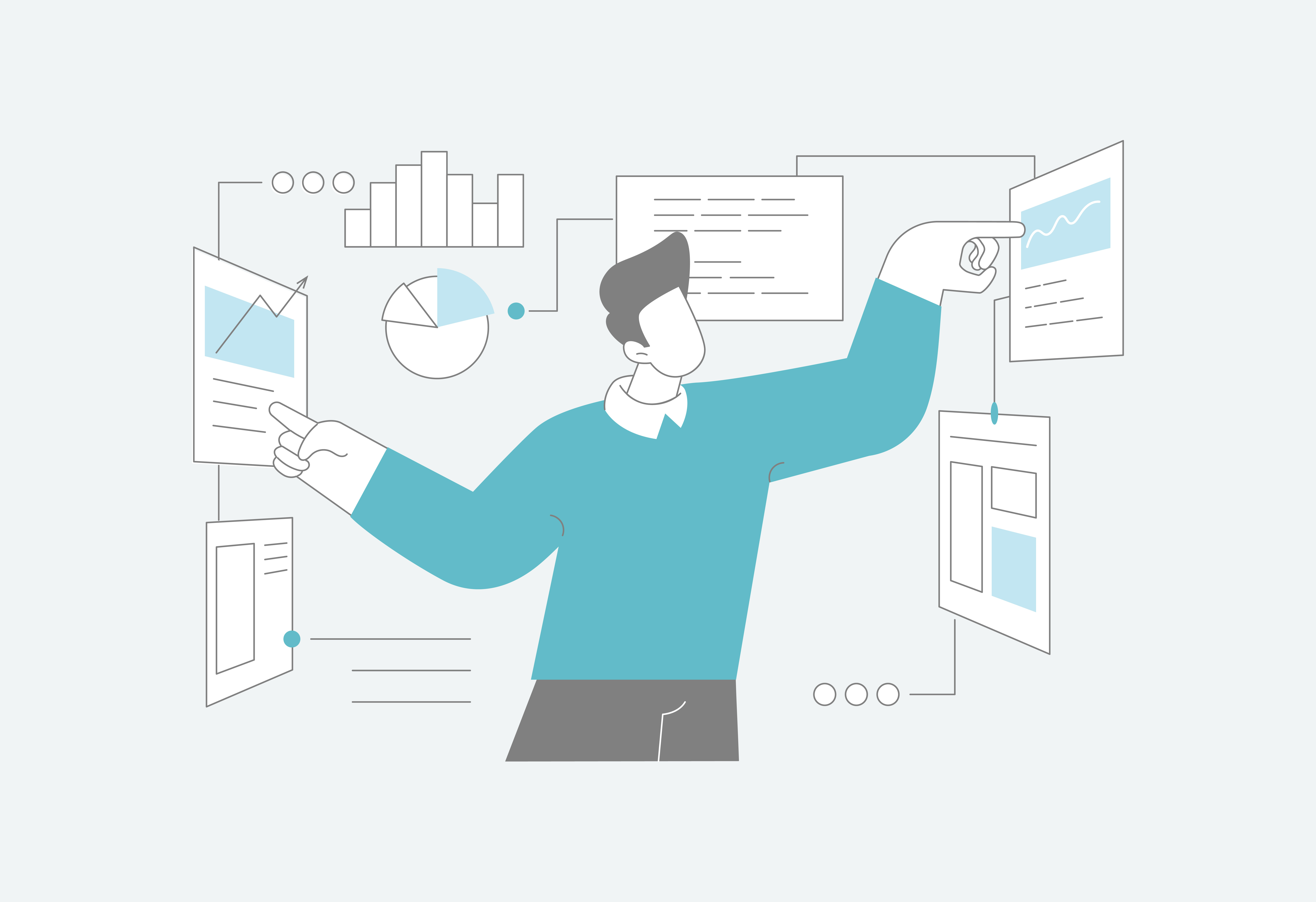
Jedes Jahr veröffentlichen Bildungsforscher:innen neue Erkenntnisse, die in den Schulen jedoch nur selten ankommen. Ein Grund dafür: Empirische Evidenz ist häufig zu abstrakt, um im Schulalltag angewandt zu werden. Damit Lehrkräfte von wissenschaftlichem Wissen profitieren, sollten sie sich verstärkt mit Theorien auseinandersetzen.
Forscherinnen und Forscher wünschen sich, dass Lehrkräfte vermehrt auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Lehr-Lern-Forschung setzen, um ihren Unterricht zu optimieren. Dies wäre insbesondere wichtig, weil die Forschung zeigt, dass sich etliche weit verbreitete Praktiken als nicht günstig erwiesen haben und nicht alle Überzeugungen von Lehrkräften mit belastbaren Befunden vereinbar sind.
Gleichzeitig zeigen viele Studien, dass die Mehrzahl der Lehrkräfte der Wissenschaft als Informationsquelle für die Praxis recht reserviert gegenüberstehen. Die meisten Lehrkräfte nutzen für die Gestaltung ihres Unterrichts primär Quellen wie ihr Erfahrungswissen als Schülerin oder Schüler sowie als Lehrkraft, Tipps von anderen Lehrkräften oder Materialien zu ihrem Schulfach. Doch kann man den Lehrkräften die oftmals geringe oder gar fehlende Nutzung der Wissenschaft anlasten? Nicht unbedingt! Vielmehr, so die zentrale Aussage dieses Beitrags, tragen viele Forscherinnen und Forscher ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in sub-optimaler Weise an Lehrkräfte heran und stützen sich dabei auf Sichtweisen, die für Lehrkräfte nur wenig praktikabel sind.
Warum die „what works"-Sichtweise für Lehrkräfte nicht funktioniert
Die Sichtweise des „what works“ ist vor allem in den USA verbreitet und nimmt an, dass man über eine integrative Zusammenfassung von Forschungsergebnissen, idealerweise über Meta-Analyse, herausfinden kann, was gut wirkt („what works"). Diese Erkenntnisse sollten Lehrkräfte anschließend umsetzen.
Was sind Meta-Analysen?
Meta-Analysen sind Studien, die die Befunde einzelner Studien zu einer Methode (beispielsweise zum kooperativen Lernen), einer Intervention (zum Beispiel dem Training zu phonologischer Bewusstheit als Voraussetzung für Schriftspracherwerb) oder einem Zusammenhang (zum Beispiel zwischen Geschlecht und Schulleistung) mit statistischen Methoden zusammenfassen. Dadurch erhoffen sich Forschende stabilere Befunde, als sie Einzelstudien liefern würden. Die international wohl bekannteste Institution, die Lehr-Lern-Forschung zusammenfasst, um für die Praxis Empfehlungen bereitzustellen, ist das „What Works Clearinghouse" des US Department of Education. Einige Meta-Analysen werden auch vom Clearinghouse Unterricht der TU München in leicht verständlicher Form aufbereitet.
Ein wichtiges Vorbild dieser Sichtweise ist die evidenzbasierte Medizin, die sich, trotz auch kritischer Stimmen, etabliert hat. Hierbei wird eine Evidenzpyramide verwendet, die verschiedene Arten der empirischen Absicherungen in eine Hierarchie bringt. An der Spitze stehen Meta-Analysen, die weitestgehend robuste Evidenz dafür liefern (sollen), wie Ärztinnen und Ärzte beispielsweise eine bestimmte Erkrankung behandeln können. Meta-Analysen als (primäre) Evidenzquelle für Lehrkräfte weisen jedoch einige Nachteile auf.
Der Beruf einer Lehrkraft beinhaltet recht vielfältige Anforderungen und Aufgaben. Insofern wäre inzwischen eine (vermutlich) vierstellige Zahl von relevanten Meta-Analysen zu rezipieren. Die Aufarbeitung dieser riesigen Menge an Literatur kann von Lehrkräften nicht sinnvollerweise erwartet werden.
Zweitens sagen Meta-Analysen – entgegen mancher Erwartung – nicht, was effektiv ist und was nicht. Diese unrealistische Erwartung wurde durch das bekannte Buch des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie befeuert, indem er über mehr als 800 Meta-Analysen berichtet. Darin bringt Hattie einzelne Lehr-Lern-Methoden mit einem einzigen Effektivitäts-Kennwert in eine Rangreihe. Eine genaue Lektüre von Meta-Analyse zeigt jedoch, dass der Fokus auf einem durchschnittlichen Effektivitätswert eher irreführend ist. In so gut wie allem Meta-Analysen hängt der Effektivitätswert in bedeutsamer Weise von einer ganzen Reihe von Kontextfaktoren ab und insbesondere von der Art der Implementation. So unterstützen Abrufübungen beispielsweise das mittelfristige Behalten von Lerninhalten nur, wenn die Abrufaufgaben auch überwiegend erfolgreich bearbeitet werden. Um die Zahl aller relevanten meta-analytische Informationen zu berücksichtigen, müsste die vierstellige Zahl an durchschnittlichen Effekten jeweils also mit einer zweistelligen Zahl an Kontext- bzw. Implementationsfaktoren multipliziert werden.
Die Lehr-Lern-Forschung ist ein expandierendes Forschungsfeld. Das ist zunächst begrüßenswert. Allerdings trägt dies nicht in jedem Fall zur Klarheit bei. Beispielsweise gibt es inzwischen für viele Methoden und Intervention zwei oder sogar eine ganze Reihe von Meta-Analysen. Deren Befunde sind jedoch selten völlig konsistent. Daher gibt es (vermeintliche) Widersprüche zwischen den Meta-Analysen, die es für Lehrkräfte noch schwieriger machen, Schlussfolgerungen für die Praxis zu ziehen.
Meta-Analyse liefern sehr viele Einzelfakten, die nicht in einen kohärenten theoretischen Rahmen eingebettet sind. Lehrkräften wird damit vor allem etwas angeboten, das man im Englischen treffend als „Knowledge-in-pieces“ bezeichnet. Dieses Wissen kann nur schlecht organisiert werden und ist nur sehr eingeschränkt geeignet, Lehrkräften ein Verständnis zu generellen Befundmustern, Prinzipien oder relativ gesicherten theoretischen Annahmen zu vermitteln.
Die Darstellungen in Meta-Analysen sind in aller Regel sehr abstrakt gehalten – und dies trifft auch auf für die Praxis aufbereitete Darstellungen zu. Lehrkräfte erhalten somit kaum Beispiele dazu, wie eine Methode oder Intervention in unterschiedlichen Kontexten umgesetzt werden kann. Dafür müssten sie wiederum in Einzelstudien nachsehen, was einen kaum zu leistenden Mehraufwand bedeutet, weshalb Lehrkräfte auf ihr Erfahrungswissen zurückgreifen, um Erkenntnisse für ihren Unterricht abzuleiten. Dadurch entfernen sie sich jedoch zwangsläufig von den empirischen Originalstudien.
Das Auflösungsniveau von Methoden oder Intervention, die in Meta-Analysen geprüften werden, ist in aller Regel vergleichsweise grob. Meist werden lediglich „Makro-Skripte" dessen skizziert, was zu tun wäre. Wenn Lehrkräfte eine dieser Methoden oder Intervention auf ihr Schulfach und ihre Klassenstufe adaptieren möchten, existieren keine Detailvorgaben, etwa in Bezug auf einzelne Formulierung oder Strukturierungen des Unterrichts auf Sekunden- oder Minutenniveau. Die Lücken im wissenschaftlichen „Makro-Skript" müssen von einer Lehrkraft in sinnvoller Weise gefüllt werden. Und dafür muss sie wiederum vor allem auf ihr Erfahrungswissen zurückgreifen.
Insgesamt gesehen scheint es daher nicht sinnvoll, Meta-Analysen als privilegierte Evidenzquelle für Lehrkräfte anzusehen, wie dies bei der „What-Works"-Sichtweise der Fall ist. Es wäre für Lehrkräfte überfordernd, sämtliche Einzelinformationen, die für den Berufsalltag relevant wären, aus dieser Art von Studien herauszuziehen und für den Unterricht fruchtbar zu machen. Zudem berücksichtigt die „What-works"-Sichtweise in zu geringer Weise, dass empirisch bewährte Methoden nicht einfach als Kopie des Studiendesigns umsetzten werden können. So müssen Lehrkräfte häufig Methoden, die beispielsweise für den Mathematik- und Physikunterricht untersucht wurden, auf ihr Schulfach, ihren Stoff, und ihre Schülerinnen und Schüler adaptieren. Es ist also eine Illusion des „What works"-Ansatzes, dass Wissenschaft Methoden oder Intervention bereitstellen kann, die in jeder Schulklasse auch „garantiert" funktionieren.
Erfahrungswissen ist wichtig: die moderate Sichtweise
Die moderate Evidenzorientierung, die von vielen Forschenden im deutschsprachigen Raum vertreten wird, überträgt die ursprüngliche Charakterisierung von Evidenzorientierung in der Medizin auf den Unterrichtskontext. Dabei stand die Integration von wissenschaftlichem Wissen und „klinischer Expertise" im Vordergrund. In der Bildungsforschung bedeutet dies, dass wissenschaftliche Evidenz im Zusammenspiel mit dem Erfahrungswissen der Lehrkräfte und ihrem Wissen über den Kontext, in dem sie unterrichten, gesehen und nutzbar gemacht werden soll.
„Je nach Anforderung, die die Lehrkraft zu bewältigen hat, können ganz unterschiedliche Studien sehr nützlich sein.“
Prof. Dr. Alexander Renkl
Zudem nimmt dieser Sichtweise eine liberalere Perspektive auf die Nützlichkeit von Evidenz ein, die Meta-Analysen nicht ausnahmslos als Evidenzquelle priorisiert. Je nach Anforderung, die die Lehrkraft zu bewältigen hat, können ganz unterschiedliche Studien sehr nützlich sein. Beispielsweise kann eine qualitative Studie, die aus der Sicht der evidenzgenerierenden Forschung eher eine eingeschränkte generelle Aussagekraft hat, für Lehrkräfte sehr nützlich sein, weil sie aufzeigt, wie eine Methode oder Intervention in einem konkreten Kontext genau umgesetzt wird und wie Lernende darauf reagieren können. Die moderate Evidenzorientierung sieht das Verwenden einer für die aktuellen Bedürfnisse einer Lehrkraft passenden Evidenzquelle somit als relevanter an als die Nutzung einer vermeintlich besten Evidenzquelle.
Ein Teil der Forschenden, die diese moderate Sichtweise vertreten, postuliert sogar, dass Lehrkräfte gar nicht primär Quellen empirischer Evidenz nutzen sollten, wie sie Einzelstudien oder Meta-Analysen bieten. Vielmehr sollten Lehrkräfte auf wissenschaftliche übergeordnete Wissensbestände zurückgreifen, wie etwa empirisch-fundierte Theorien oder damit in Bezug stehende Prinzipien. Während Einzelstudien oder Meta-Analyse empirische Studien zu sehr spezifischen Fragen liefern, berücksichtigen empirisch-fundierte Theorien einerseits die Befunde von Studien und Meta-Analysen, gehen aber andererseits darüber hinaus, indem sie einen kohärenten Erklärungsrahmen zu einem Phänomenbereich, etwa intrinsische und selbstbestimmte Motivation, bereitstellen. In Theorien und Prinzipien sind die empirischen Befunde damit gleichsam kondensiert abgebildet, was einige Vorteile mit sich bringt.
Warum Lehrkräfte verstärkt mit Theorien arbeiten sollten
Theorien bieten ein kohärentes und erklärendes Wissen, das es Lehrkräften zu verstehen erlaubt, warum eine Maßnahme in einem Bereich günstige Effekte hat oder haben kann. Damit werden schlüssige Alternativen zu ungünstigen Überzeugungen angeboten.
„Theorien dienen als kognitive Werkzeuge, die es erlauben, informierte Entscheidungen zu treffen.“
Prof. Dr. Alexander Renkl
In der konkreten Nutzung haben Theorien den Vorteil, dass Lehrkräfte nicht erst nach empirischer Evidenz suchen, diese verarbeiten und auf den eigenen Kontext hin interpretieren müssen, wenn sie Unterricht zu einem neuen Lernstoff planen. Theorien können als kognitive Werkzeuge dienen, die es erlauben, informierte Entscheidungen zu treffen. Überlegt eine Lehrkraft zum Beispiel, ob sie bei der Einführung in ein Thema aus der Physik eher das Lehrbuch verwendet oder die Materialien, die von einer Kollegin „heiß" empfohlen wurden, kann sie die beiden Materialien dahingehen bewerten, inwiefern sie mit einschlägigen Theorien vereinbar sind. Auf diese Weise kann sie sich für das Material entscheiden, bei dem sie mehr Verbindungen zu bewähren Theorien sieht. Dies kann als Entscheidung nach dem sogenannten Konnektivitätsprinzip angesehen werden, bei dem das Ausmaß an „Konnex" zu bewährten Theorien den Ausschlag gibt.
Wie theoretisches Wissen hilft, Methoden anzupassen
Bei der Diskussion zur Evidenzorientierung geht es vielfach darum, welche Methoden effektiv sind, dabei wird häufig außer acht gelassen, dass Methoden nicht in jeder Situation effektiv sind. Vielmehr kommt es darauf an, dass Lehrkräfte beispielsweise die Lernvoraussetzung ihrer Schülerinnen und Schüler diagnostizieren und bedeutsame Ereignisse im Unterrichtsgeschehen bemerken und angemessen interpretieren können Auf der Basis solcher „Diagnosen", können anschließend bestimmte Methoden eingesetzt werden. Speziell für das theoriebasierte Beobachten und Interpretieren liegen überzeugende Befunde vor, dass Lehrkräfte, die eine gewisse Stärke in diesem Bereich mitbringen, einen besseren Unterricht halten und Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernerfolg fördern.
Eher selten wurde eine Methode in genau demselben Land und Schulsystem, in derselben Schulart, in derselben Klassenstufe, in demselben Fach, genau beim gleichen Schulstoff und sehr ähnlichen Lernvoraussetzungen in der Klasse untersucht. Insofern sind notwendige Adaptation eher die Regel als die Ausnahme. Dadurch kann es allerdings passieren, dass Lehrkräfte die Methode so verändern, dass ihre Wirkung verloren geht. Diese Gefahr besteht vor allem, wenn die Lehrkräfte kein theoretisches Verständnis dahingehend haben, was die „aktiven Ingredienzien" einer Methode sind und wie sie genau zur Wirkung kommen. Fundiertes theoretisches Wissen hilft also im Zusammenspiel mit Erfahrungswissen und Kontextwissen, sinnvolle Anpassungen von Methoden vorzunehmen.
Gleichzeitig gilt, dass das Problem der Nutzung wissenschaftlichen Wissens in der Praxis ein sehr komplexes Problem darstellt, das seit vielen Jahrzehnten diskutiert wird und weitgehend ungelöst ist. Eine stärkere Betonung von Theorie im Vergleich zu empirischer Evidenz kann hier nur ein – wenngleich wichtiger – Baustein sein, um dieses Problem zu lösen.
Kurz und bündig: Worauf Lehrkräfte bei evidenzorientiertem Unterricht achten sollten
Wissenschaftliches Wissen ist eine wichtige Informationsquelle für die Praxis von Lehrkräften. Sie ist insbesondere ein wichtiges Korrektiv zu vielfach anzutreffenden ungünstigen Überzeugungen und Praktiken.
Wissenschaftliches Wissen ist jedoch zu abstrakt und zu wenig detailliert, um als die alleinige oder auch nur als die in jedem Fall dominierende Quelle dienen zu können. Wichtig ist die Integration mit dem Erfahrungswissen und dem Kontextwissen der Lehrkräfte.
Je nach Zweck oder Problemstellung können ganz unterschiedliche Quellen wissenschaftlichen Wissens eine günstige Alternative darstellen.
Theorien sind besonders nützliche kognitive Werkzeuge für die Alltagspraxis. Sie bieten Lehrkräften kohärentes Wissen und erlauben ein theoretisches Verständnis in Hinblick auf Fragen des Lernens und Lehrens. Zudem tragen sie dazu bei, Problemsituationen angemessen zu interpretieren und darauf basierend günstige Handlungsentscheidungen zu treffen. Schließlich sind sie wichtig, wenn wissenschaftlich bewährte Methoden auf einen konkreten Kontext (zum Beispiel das Schulfach oder die Lernvoraussetzung der Klasse) hin angepasst werden müssen.
Die Anwendung von wissenschaftlichem Wissen im Zusammenspiel mit Erfahrungs- und Kontextwissen garantiert keineswegs Erfolg bei einer ersten Umsetzung, etwa einer Lehr-Lern-Methode. Wichtig ist, den Erfolg erster Anwendungen kritisch zu überprüfen und das „Trio" aus wissenschaftichem Wissen, Erfahrungswissen und Kontextwissen zu nutzen, um eine Methode weiter zu optimieren.
Die Anwendung wissenschaftlichen Wissen ist idealer Weise weniger ein zeitlich eng begrenztes und am Ende abgeschlossenes Vorhaben als ein fortlaufender Prozess der allmählichen Optimierung der Unterrichtspraxis.





