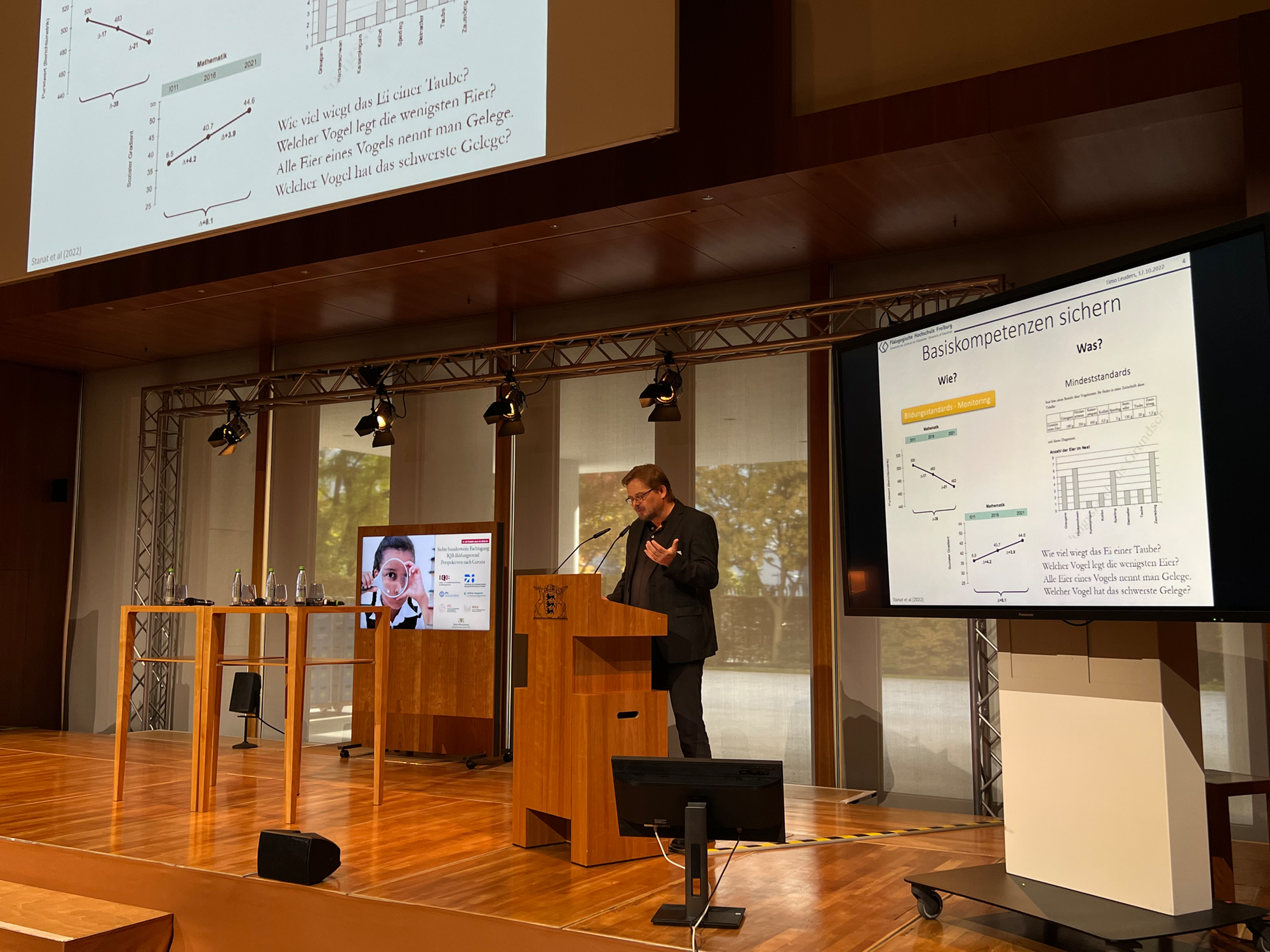Sprachförderung im integrativen Modell – wie gut funktioniert das wirklich?
Im Interview schildert Junior-Professorin Simone Plöger, wie mit neu zugewanderten Kindern integrative Spracharbeit in einer Hamburger Schule umgesetzt wurde.

Wie erfolgreich ist Sprachförderung in Form des integrativen Modells, das versucht, Vorbereitungsklassen und Regelklassenbesuch zu vereinen? Juniorprofessorin Simone Plöger hat dazu zwei Jahre an einer Hamburger Schule geforscht. Im Interview berichtet sie von den praktischen Chancen und Grenzen des Ansatzes und erläutert, warum er ohne eine gesamtschulische Kraftanstrengung kaum machbar ist.
Redaktion: Frau Plöger, Sie haben zwei Jahre lang an einer Hamburger Stadtteilschule zum integrativen Modell für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler geforscht und dort vor allem 10- bis 14-Jährige begleitet. Können Sie die wichtigsten Grundzüge des Modells umreißen und schildern, wie es in der von Ihnen untersuchten Praxis umgesetzt wurde?
Jun.-Prof. Dr. Simone Plöger: Beim integrativen Modell der Sprachförderung geht es darum, dass die zugewanderten Schülerinnen und Schüler an zwei Klassen-Kontexten teilnehmen. Sie sind zum einen von Beginn an Teil einer regulären Klasse, zum anderen erhalten sie eine spezifische Sprachförderung, die zusätzlich zum regulären Unterricht stattfindet. In der von mir untersuchten Schule in Hamburg wurde das integrative Modell so umgesetzt, dass die Kinder anderthalb Stunden am Tag in einer Vorbereitungsklasse Deutsch gelernt und den restlichen Tag in den Regelklassen verbracht haben. Sie waren also nahezu unmittelbar an den regulären Schulunterricht angebunden.
Redaktion: Wo liegen den Erkenntnissen Ihrer Forschung zufolge die Herausforderungen dieses Modells?
Plöger: Herausforderungen waren auf mehreren Ebenen auszumachen. Eine der größten aufseiten der Schule war die Integration der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen. Oftmals gab es auf die grundlegende Frage „Wer ist in den Regelklassen eigentlich zuständig für die zugewanderten Kinder?” keine zufriedenstellende Antwort. Im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für die es Konzepte wie Förderlehrkräfte oder Schulbegleitung gibt, ist eine solche Unterstützung für zugewanderte Kinder nicht vorhanden. Es fehlte also an spezifischen pädagogischen Fachkräften, die sich explizit zuständig fühlten. In der Praxis bedeutete dies, dass Klassenlehrkräfte die Situation aus ihren pädagogischen Ressourcen stemmen mussten, sich also sowohl um eine ganze Klasse und gleichzeitig um das zugewanderte Kind kümmern mussten. Das war vielfach schlicht nicht zu leisten.
Verschärfend kam hinzu, dass sich die untersuchte Schule von ihrem inklusiven Selbstverständnis her von dem, was eigentlich in Hamburg üblich ist, ein Stück weit emanzipiert hat und ihren eigenen Weg gegangen ist. Denn in Hamburg ist es grundsätzlich so geregelt, dass die Kinder zunächst ein Jahr in der Vorbereitungsklasse bleiben. In dieser Schule wurde aber im Sinne des integrativen Modells unmittelbar der Anschluss an die Regelklasse organisiert und die Vorbereitungsklasse auf anderthalb Stunden täglich reduziert. Das hat dazu geführt, dass die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen nur in den Vorbereitungsklassen offiziell gezählt wurden. Die Regelklassen, in denen die maximale Klassenstärke l eigentlich bei 23 Lernenden liegt, wuchsen so aber oftmals auf 25 oder 26 Schülerinnen und Schüler an. Das ist natürlich eine erhebliche Herausforderung, besonders wenn diese zusätzlichen Klassenmitglieder zumindest am Anfang kaum oder gar kein Deutsch sprechen.
Redaktion: Wie erlebten die zugewanderten Schülerinnen und Schüler diese Situation?
Plöger: Aus Perspektive der Neuzugänge war es besonders herausfordernd, dass sie immer wieder aus den Regelklassen herausgerissen wurden. Die Stundenpläne der Regelklasse waren nicht mit denen der Vorbereitungsklasse abgestimmt, was dazu führte, dass die zugewanderten Schülerinnen und Schüler mal Mathematik, mal Projektunterricht, ein anderes Mal dann Sport verpasst haben. Sie kamen also immer wieder in den regulären Unterricht, ohne zu wissen, was in den letzten anderthalb Stunden passiert war. Gleichzeitig hatte die Lehrkraft keine Möglichkeit oder kaum Kapazitäten, die Zugewanderten in diesen Situationen aufzufangen, sodass sie wiederum nur eingeschränkt am Unterricht teilnehmen konnten. Dar war ein großes Problem, mit dem diese Lernenden zusätzlich zu der individuellen Sprachbarriere zu kämpfen hatten.
„Zugewanderte haben in den Regelklassen über schwerere, persönliche Themen wie Flucht kaum gesprochen, in der Vorbereitungsklasse waren solche Themen dagegen ständig Bestandteil der Gespräche.“
Jun.-Prof. Dr. Simone Plöger
Redaktion: Wie haben die zugewanderten Schülerinnen und Schüler selbst die Vorbereitungsklasse bewertet?
Plöger: Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler war hier ambivalent, weil die Situationen doch individuell sehr verschieden waren. Manche von ihnen – oftmals jene mit gewissen grundlegenden Kenntnissen in Deutsch – haben in meinen Interviews deutlich gemacht, es brauche die Vorbereitungsklasse nicht, sie würden lieber ausschließlich in die Regelklasse gehen, um dort nichts zu verpassen. Aber für andere ist die Vorbereitungsklasse durchaus ein sehr wichtiger Kontext. Zum einen natürlich für die regelmäßige sprachliche Unterstützung und Festigung des Gelernten, zum anderen haben in den Vorbereitungsklassen auch ganz andere Themen Platz gefunden als in den Regelklassen. So haben die Zugewanderten etwa über schwerere, persönliche Themen wie Flucht in den Regelklassen kaum gesprochen, in der Vorbereitungsklasse waren solche Themen dagegen ständig Bestandteil der Gespräche. Dort finden sich Kinder und Jugendliche zusammen, von denen viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Redaktion: Wie ist es der Schule trotz der ständigen Fluktuation zwischen Vorbereitungs- und Regelklasse gelungen, dennoch einen funktionierenden Unterricht für die zugewanderten Kinder zu gewährleisten?
Plöger: Ein sehr wichtiges Erfolgskriterium dafür war die Tatsache, dass die Hamburger Schule in den Klassen mit individuellen Lehrplänen gearbeitet hat. Die Schule setzt dieses Konzept bereits seit 2009 um, und war daher sehr trainiert darin, auf die jeweiligen Lernbedarfe der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Im Unterricht gestaltete sich das so, dass es zunächst eine Phase gab, in der etwas gemeinsam gemacht wurde. Danach setzten Individualphasen ein, was den neu zugewanderten Schülern oftmals zugute kam. So konnten sie dann beispielsweise in Mathe mit Aufgaben ohne viel Text üben und ihre Fähigkeiten zeigen. Allerdings muss man auch sagen, dass nicht alle zugewanderten Schülerinnen und Schüler von individuellen Lernplänen profitieren konnten Für manche mit besonders großen Sprachhürden waren auch diese nicht zu bewältigen. So bekamen sie dann teilweise von der Lehrkraft in der Vorbereitungsklasse Lernmaterial, das auf Lernende mit Deutsch als Zweitsprache ausgerichtet war. Dieses war aber oftmals deutlich zu niedrig im Niveau, hier bekamen etwa Jugendliche Matheaufgaben für Zweitklässler vorgelegt. Diese Art der „Ruhigstellung“ birgt natürlich Gefahren.
Redaktion: Was würden Sie als weitere kritische Erfolgsfaktoren werten in Ihren Beobachtungen zum integrativen Modell?
Plöger: Sehr wichtig für den Erfolg des integrativen Modells an der Schule war, dass die Entscheidung dafür gemeinsam mit Lehrkräften, Eltern und Lernenden getroffen wurde. Es haben also prinzipiell alle an einem Strang gezogen. Es zeigte sich auch in so gut wie jedem meiner Interviews an der Schule ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl und Bewusstsein für die inklusive Schulkultur. Immer wieder wurde von allen Parteien gesagt: „Wieso sollten wir das anders machen? Wir sind eine inklusive Schule, und wenn wir sagen, alle Kinder sind an unserer Schule willkommen, dann ist das auch so.” Diese offene, inklusive Haltung haben auch explizit die Schülerinnen und Schüler in den Regelklassen selbst vertreten.
Ein weiteres Erfolgskriterium war, dass mit den Ressourcen, die durch die Reduzierung der Zeit in der Vorbereitungsklasse frei wurden, eine Kulturmittlerin angestellt wurde. Diese deckte für die zugewanderten Kinder den ganzen außerunterrichtlichen Kontext ab und wurde so schnell zu einer extrem wichtigen Bezugs- und Vertrauensperson. Sie hat Familiengespräche geführt, die Neuankömmlinge in den Stadtteil integriert und ihnen gezeigt, wo sie Hilfe finden, hat also viel wichtige pädagogische und familiäre Arbeit geleistet.
Redaktion: An welchen Stellen haben Sie in Ihrem Fallbeispiel entscheidende Dinge vermisst, die dem Erfolg des Modells zuträglich gewesen wären?
Plöger: Zum einen fehlt es besonders in den Regelklassen an Ressourcen, um mehr und bessere Spracharbeit zu gewährleisten. Dazu gehört auch das Aufgreifen der Mehrsprachigkeit der zugewanderten Kinder, hier wurden viele Chancen liegengelassen. Zum anderen braucht es eine deutlich bessere Verzahnung von Regel- und Vorbereitungsklassen. Das ist eine große organisatorische Hürde, aber es wäre doch sehr hilfreich, wenn etwa der Deutschunterricht in der Vorbereitungsklasse immer parallel zum Deutschunterricht in der Regelklasse stattfindet. Eine inhaltliche Verbindung zwischen den Themen aus dem Unterricht in der Regelklasse und dem in der Vorbereitungsklasse würde den Kindern das Lernen erleichtern. Grundsätzlich fehlte es hier an der von mir untersuchten Schule auch an Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften.
Zudem hat sich in meiner und auch in vielen anderen Studien gezeigt, dass das Personal in der Vorbereitungsklasse nicht qualifiziert war für diese Stelle, es sich also nicht um ausgebildete „Deutsch als Zweitsprache”-Lehrkräfte handelte. Das ist problematisch, weil gerade in der Vorbereitungsklasse natürlich ein qualifizierter, hochwertiger Unterricht stattfinden muss, damit die Kinder die kritischen Sprachhürden überwinden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Entscheidungen darüber, ob eine Schülerin oder ein Schüler vollständig in die Regelklasse wechseln kann oder nicht. Diese sollten nicht allein von einer Person getroffen werden, um sicherzustellen, dass hier nicht Präferenzen, sondern transparente Kriterien die Basis für die Entscheidungen bilden.
„Die Schule hat viel dafür getan, dass die zugewanderten Schülerinnen und Schüler ganz natürlicher Teil der Schulgemeinschaft waren.“
Jun.-Prof. Dr. Simone Plöger
Redaktion: Wie würden Sie insgesamt den Erfolg des Modells bei der Integration der zugewanderten Kinder und Jugendlichen bewerten?
Plöger: Der fällt individuell sehr unterschiedlich aus. Insgesamt zeigt sich aber schon, dass sich die Schülerinnen und Schüler sozial sehr schnell in die Regelklassen integriert haben. Selbst jene, die am Unterricht zunächst wegen der Sprachbarriere nur eingeschränkt mitwirken konnten, haben etwa in den Pausen Zeit mit Leuten aus der Regelklasse verbracht. Die Schule hat viel dafür getan, dass die neu Zugewanderten ganz natürlicher Teil der Schulgemeinschaft waren, sie waren etwa immer bei Klassenausflügen dabei. Das ist das Besondere des integrativen Modells: Die zugewanderten Kinder und Jugendlichen müssen hier nicht erst beweisen, dass sie Schülerin oder Schüler einer Regelklasse sein können, sondern es wird von vornherein signalisiert: Wir erkennen euch als neue Mitglieder an – und dann wird geschaut, welchen Bedarf ihr habt und welche Unterstützung nötig ist.
Redaktion: Was würden Sie aus Ihrer mehrjährigen Forschungserfahrung Schulleitungen und Lehrkräften mitgeben, die sich bemühen, das integrative Modell an ihrer Schule umzusetzen? Worauf muss der Fokus liegen, damit diese Art der Sprachförderung erfolgreich ist?
Plöger: Es ist sehr wichtig, dass sich alle an der Schule verantwortlich fühlen müssen für die Umsetzung eines integrativen Ansatzes. Sprachförderung muss Teil der Schulentwicklung sein, es ist eine gesamtschulische Anstrengung, für die es ein Konzept, eine hohe fachliche Qualifikation und gute Kommunikation braucht. Sie kann nicht ausschließlich an einzelne Personen delegiert werden. Natürlich kann es Zuständigkeiten geben, aber diese müssen klar verteilt werden. Ganz konkret für die pädagogische Arbeit bedeutet das Modell: Wir nehmen dich erst einmal als Schülerin oder Schüler wahr – nicht als geflüchtetes Kind. Wir konnten in unserer Forschung beobachten, dass oft eher extremere Perspektiven vorherrschten: Dass einerseits Kompetenzen per se abgesprochen wurden, weil es an Deutschkenntnissen fehlte, und andererseits die Kinder sehr stark mit Mitleid und als Opfer gesehen wurden. Diese Kinder und Jugendlichen haben oft so viel mehr erlebt als wir in unserem ganzen Leben erleben werden, sie haben oftmals extreme Erfahrungen hinter sich und große Resilienz bewiesen. Sie verdienen dafür Respekt und eine Chance, sich als Lernende zu beweisen.
Redaktion: Frau Junior-Professorin Plöger, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Zur Person
Simone Plöger ist Junior-Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Inklusion an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Prozesse der Inklusion und Exklusion, Diversität und soziale Ungleichheit im Kontext schulischer Bildung sowie die Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler.